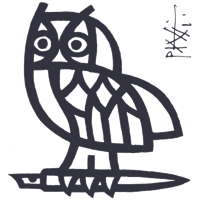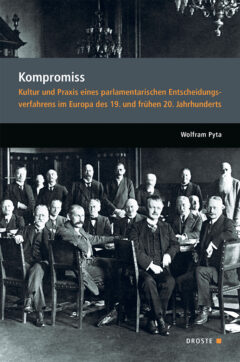Parlamente und Parlamentarismus in Europa
Parlamentarismus und Parlamentarisierung sind Ergebnisse transnationaler und interdependenter politischer Transferprozesse. Mit ihrem Forschungsschwerpunkt »Parlamente und Parlamentarismus in Europa« trägt die KGParl dieser Tatsache Rechnung. Dabei wird das Ziel verfolgt, bisherige Forschungen der KGParl zum deutschen Parlamentarismus um eine europäisch-vergleichende Perspektive zu erweitern. Damit verbunden ist eine thematische Konzentration auf die Entwicklung parlamentarischer Kultur(en) in Europa. Es gilt, durch vergleichend-systematisierende Untersuchungen Symbole, Rituale und Kommunikationsformen der Parlamente Europa auszuwerten und damit das Potential symbolischer Kommunikation auszuloten. Der Forschungsschwerpunkt knüpft also explizit an anthropologische und kulturgeschichtliche Fragestellungen an.
Ein europäisches Thema mit vergleichenden Fragen kann sinnvollerweise nur in Kooperation mit europäischen Forschungsinstituten untersucht werden. Dies geschieht vor allem mittels internationaler wissenschaftlicher Konferenzen. So initiierte die KGParl die Konferenzserie »Parlamentarische Kulturen in Europa im historischen Vergleich«. Dabei wurden Themen aufgegriffen, die sich ausgehend vom Vergleich für die Diskussion von Grundsatzfragen eignen: »Das Parlament als Kommunikationsraum«, »Lebenswelten von Abgeordneten in Europa«, »Das ideale Parlament« sowie »Antiparlamentarismus und Parlamentarismuskritik«.
Kompromiss. Kultur und Praxis eines parlamentarischen Entscheidungsverfahrens im Europa des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
Der Kompromiss als geregeltes Verfahren zwischen entscheidungsbefugten Akteuren ist ein nachgefragtes Gut im politischen Alltagsleben. Daher verwundert es, dass zur Genese dieses Entscheidungsverfahrens keine vergleichenden Abhandlungen existieren.
Der vorliegende Band leistet einen Einstieg in das Forschungsfeld einer europäisch vergleichenden Geschichte des Kompromisses seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Er untersucht komplexe Verhandlungssysteme in sieben europäischen Staaten, die institutionell auf Kompromissbildung ausgerichtet waren. Der interdisziplinäre Zuschnitt des Querschnittsthemas »Kompromiss« wird durch Beiträge aus Soziologie, Politikwissenschaft und Politolinguistik eingelöst. Insgesamt schärft der Band den Blick dafür, dass der Kompromiss eine spezifische Kultur des Verhandelns benötigte, die vor allem in parlamentarischen Vertretungskörperschaften gedieh. Parlamentarisch gestaltete Kompromisse waren immer dann abrufbar, wenn die politische Sprache dem Kompromiss zuarbeitete und ihn ins Werk setzen konnte.
Das Forschungskonzept geht davon aus, dass Gemeinsamkeiten, die im Wesen des Parlamentarismus liegen, auch jenseits einer verfassungs- und politikgeschichtlichen Dimension zu erkennen sind und letztlich politische und kulturelle Prozesse erklärbar machen. Auf der anderen Seite muss das Konzept und die Vorannahme einer gemeinsamen parlamentarischen Tradition sich auch immer wieder in Frage stellen, mit anderen Worte: Es gilt, auch die Unterschiede, ihre Wurzeln und Auswirkungen zu beachten. Besonders zu betrachten ist die oft konstatierte Vorbildfunktion sowohl des englischen Parlaments als »mother of parliament« als auch des französischen Parlamentarismus als Geburtsort der Gewaltenteilung.
In diesem Zusammenhang ist es ein Anliegen der Kommission, nicht nur die besser erforschten westeuropäischen Parlamente, sondern auch die der Nationalstaaten Ostmitteleuropas und deren Vorgeschichte in den multiethnischen Großstaaten des 19. Jahrhunderts einzubeziehen. Immerhin kann – um ein Beispiel zu nennen – auch das ungarische Parlament auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken – freilich mit einer anderen neuzeitlichen Entwicklung als das britische Vergleichsbeispiel.
In der Zukunft sollen zudem die vergleichende Parteiengeschichte, die Geschichte der Wahlen und Wahlkämpfe, sowie das Europaparlament mit seiner besonderen Struktur und Kommunikationssituation in die Forschungen miteinbezogen werden.
Kontakt: Tobias Kaiser